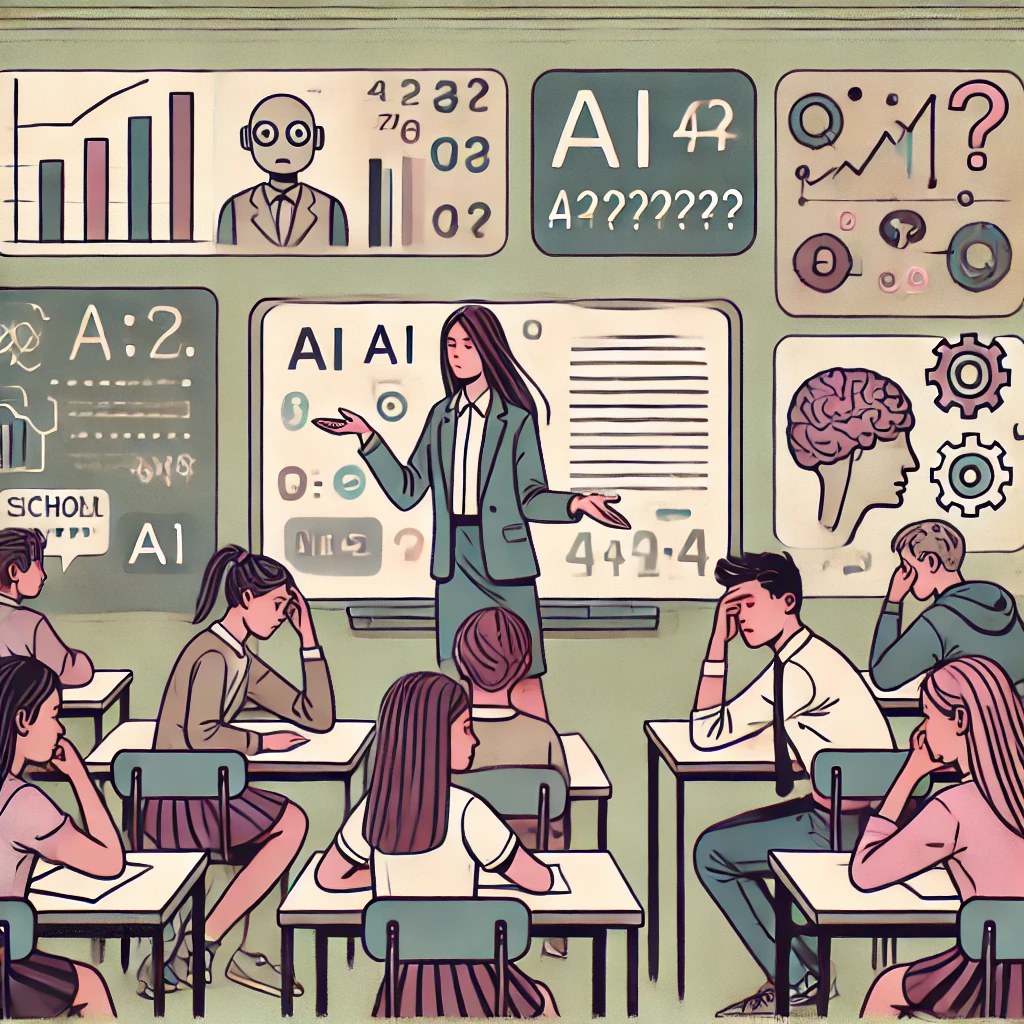Vous souhaitez réagir sur le sujet? Vous avez une remarque générale sur le blog? Écrivez‑nous un courriel, nous nous réjouissons de lire votre retour.
Content navigation
Accompagner la transition numérique
Qui n’a jamais entendu parler de ChatGPT et autres grands modèles de langage? Dans le dernier article du blog, Wendelin Brühwiler parle des évolutions et défis actuels liés à la transition numérique et explique le rôle que la CDIP a à jouer dans ce domaine.
Les articles du blog sont publiés uniquement dans leur langue d’origine.
Die digitale Transformation im Bildungssystem hatte in letzten fünf Jahren zwei grosse Treiber: die Covid-Pandemie ab 2020 und den Boom von Large Language Models wie ChatGPT. Wie gehen wir in einem föderalen System im Bildungsbereich sinnvoll mit diesen Entwicklungen um? Und welche Rolle spielt hierbei die EDK?
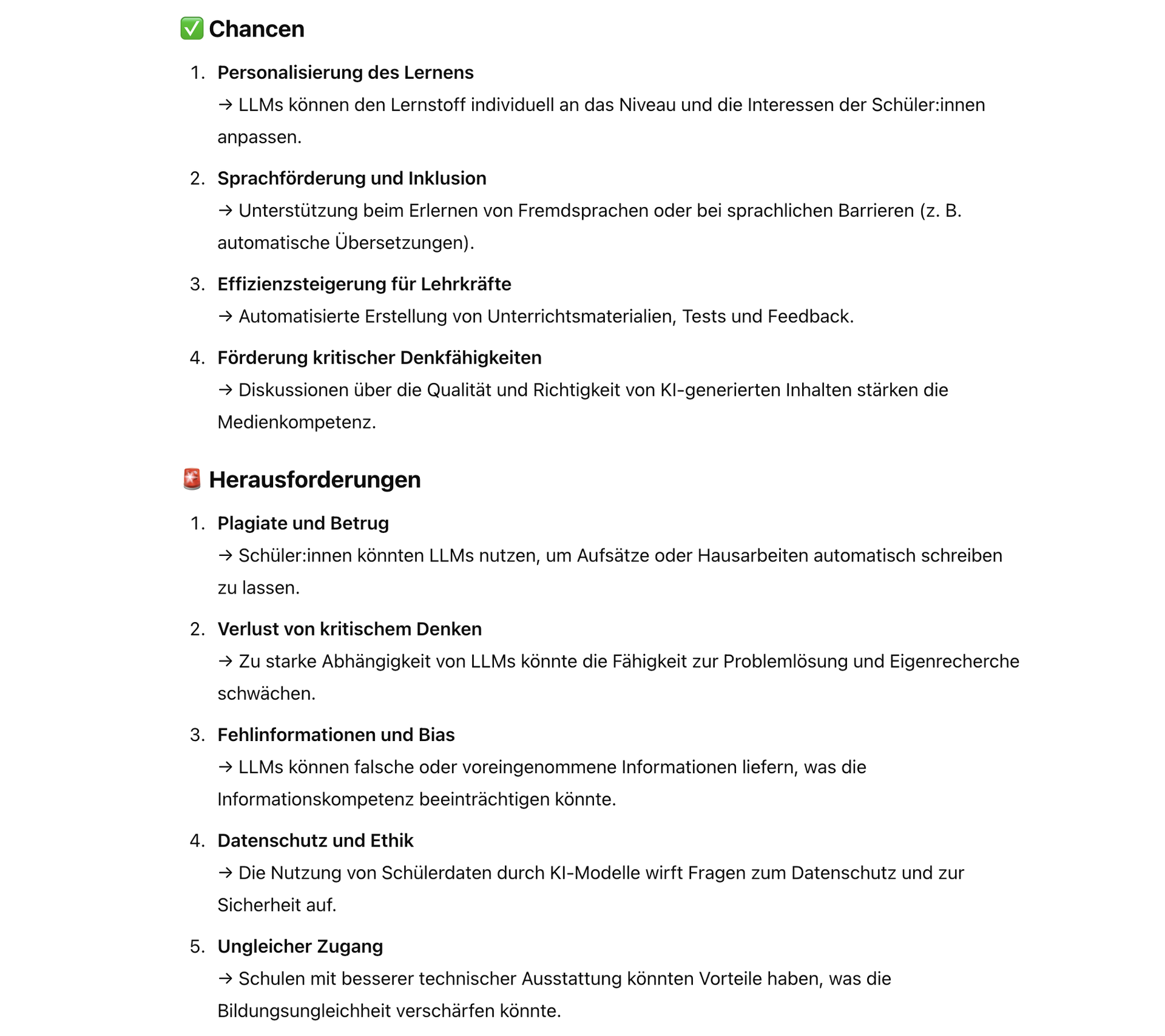
Wie kann man mit diesen (offenen) Entwicklungen in einem föderalen System mit einer kulturell und politisch heterogenen Ausgangslage sinnvoll umgehen? Bei einer – im internationalen Vergleich gemessenen – grossen Spannweite an Zeit, die Schülerinnen und Schüler für die Nutzung von digitalen Medien im Unterricht aufwenden? In einem Bereich wie der Bildung, für dessen Qualität der Einzelfall, die je spezifische Ausgestaltung des Unterrichts und Schulalltags, zentral ist?
Die EDK fördert die wissenschaftliche Beobachtung der Entwicklungen…
Von Zuständigkeitsfragen abgesehen, spricht vieles dafür, den Raum für die Entscheidungen in den lokalen Kontexten offen zu lassen. Es sollte also nicht darum gehen, die digitale Transformation zu forcieren, sondern darum, die Voraussetzungen zu ihrer Gestaltung durch die Akteure selbst zu verbessern. Wie die EDK ihre Rolle dabei auffasst, lässt sich an zwei Beispielen verdeutlichen.
Gemeinsam mit dem Bund befördert die EDK die wissenschaftliche Beobachtung der Entwicklungen. Das SBFI und die EDK geben Impulse für Einzelstudien sowie für die Integration von Modulen zur Digitalisierung in bestehende Instrumente des Bildungsmonitorings. Darüber hinaus beauftragen sie ihre Fachagentur SKBF mit einem Monitoring zur Digitalisierung aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. Zudem führt sie den internationalen Austausch, um die Entwicklungen in der Schweiz anhand der Entwicklung in anderen Staaten zu perspektivieren. Dieser Austausch bietet Anregungen und es eröffnen sich Gelegenheiten, sofern gewünscht, für Anschlussfähigkeit zu sorgen, etwa im Fall der Ratifizierung der KI-Konvention des Europarats, die einige bildungsspezifische Implikationen hat.
… und findet Lösungen in Bezug auf die Informationssicherheit und den Datenschutz
In der Anwendung von Software stellen sich Fragen der Informationssicherheit und des Datenschutzes, die von den Verantwortlichen in der Praxis kaum zu überblicken sind. Das Bedürfnis nach einer Entlastung ist hier unbestritten, namentlich in der obligatorischen Schule. Mit der Föderation der Identitätsdienste im Bildungsraum Schweiz und dem entsprechenden Login-Dienst (Edulog) tragen die Kantone im Rahmen der EDK zur Verbesserung der Situation bei. Über Verhandlungen zu Softwarelizenzen, bei denen die Fachagentur Educa die Interessenvertretung der öffentlichen Hand gegenüber privaten Anbieterinnen und Anbietern wahrnimmt, kann diese Initiative in ihrer Wirksamkeit unterstützt werden.
Digitale Technologien sind weder neutrale noch unschuldige Hilfsmittel. Wie jede Technologie führen sie in unsere Praxis etwas ein, was nicht ohne Weiteres aus der Perspektive ihres Vollzugs thematisch werden kann. So äussert sich eine kritische Technikphilosophie. Sie unterstreicht damit die Bedeutung der Rahmenbedingungen auf unterschiedlichen Ebenen: von rechtlichem Schutz, von praktischen Hilfestellungen und Informationsangeboten, von fundierten Entscheidungsgrundlagen. Sie unterstreicht aber nicht minder die Bedeutung des pädagogischen Engagements derjenigen, die mit dem Einzug der Technik in die Klassenzimmer konfrontiert sind.