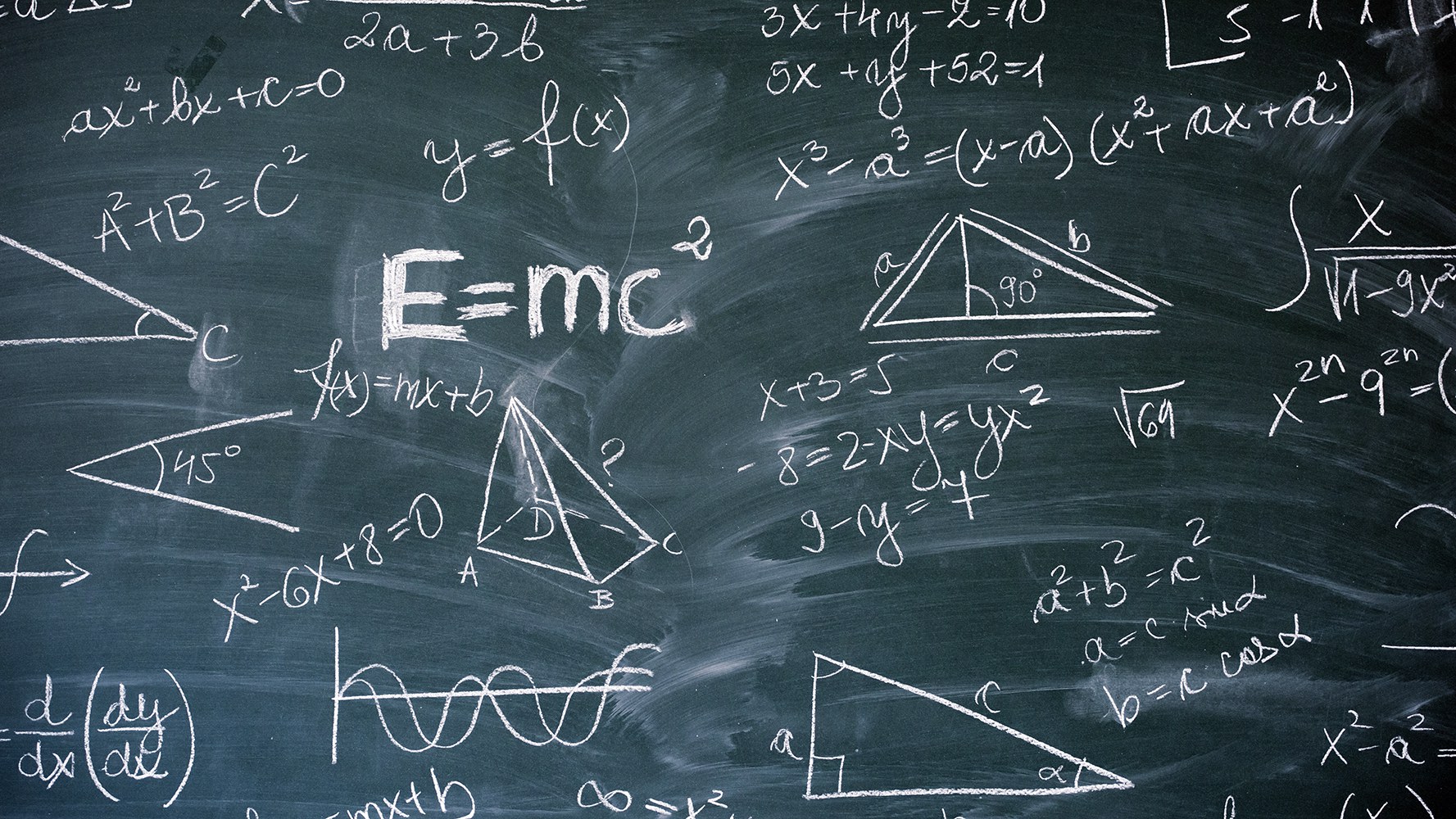Vous souhaitez réagir sur le sujet? Vous avez une remarque générale sur le blog? Écrivez‑nous un courriel, nous nous réjouissons de lire votre retour.
Content navigation
Nouvelles modalités pour le monitorage des compétences fondamentales
Le monitorage des compétences fondamentales, qui vise désormais à établir si les élèves se trouvant en 8e et en 11e année de scolarité ont atteint certaines de ces compétences, suivra un rythme quadriennal – les explications de Peter Lenz.
Les articles du blog sont publiés uniquement dans leur langue d’origine.
Testen im Dienste der Harmonisierung des Bildungssystems Schweiz
Die EDK arbeitet seit Beginn der 2000er Jahre auf eine Stärkung der Bildungskooperation unter den Kantonen hin. Dies mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, den Austausch zwischen den Kulturen zu fördern sowie die Mobilität im Land zu erleichtern. Nach entsprechenden Bemühungen auch auf Bundesebene hat die Stimmbevölkerung im Jahr 2006 die sogenannte Bildungsverfassung angenommen, die wichtige Eckwerte der obligatorischen Schule wie zum Beispiel das Schuleintrittsalter auf nationaler Ebene regelt. Im Jahr 2007 haben die kantonalen Erziehungsdirektorinnen und direktoren ihrerseits das HarmoS-Konkordat verabschiedet. Es legt unter anderem fest, dass zur gesamtschweizerischen Harmonisierung der Unterrichtsziele nationale Bildungsstandards definiert werden, die auch regelmässig überprüft werden.
Im Jahr 2011 wurden die «Grundkompetenzen» verabschiedet. Das sind Bildungsstandards, die beschreiben, was am Ende der drei Zyklen der obligatorischen Schule alle Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen Mathematik, Schulsprache, Fremdsprachen und Naturwissenschaften können sollten. Ab 2016 wurde das Erreichen der Grundkompetenzen bisher dreimal im Rahmen der «Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen» (ÜGK) überprüft: 2016 Mathematik im 11. Schuljahr; 2017 Schulsprache und Fremdsprachen im 8. Schuljahr; 2023 Schulsprache und Fremdsprachen im 11. Schuljahr. Für 2024 ist eine vierte ÜGK-Erhebung in Vorbereitung, diesmal betrifft sie Schulsprache und Mathematik im 4. Schuljahr.
An den ÜGK-Erhebungen nehmen nicht alle Schülerinnen und Schüler teil, sondern jeweils Stichproben. Diese sind mit rund 20 000 Schülerinnen und Schülern so gross, dass sie für jeden Kanton als repräsentativ gelten. In den Ergebnisberichten zu den Erhebungen wird ausgewiesen, welcher Anteil der Schülerinnen und Schüler in jedem Kanton über die Grundkompetenzen verfügt. Dank den Daten, die zusätzlich erhoben werden (administrative Daten und Fragebogendaten), ist es möglich, Erklärungsansätze für die Ergebnisse zu finden. Dabei gilt das Hauptaugenmerk jenen Schülerinnen und Schülern, die nicht gezeigt haben, dass sie über die Grundkompetenzen verfügen. Die Kantone haben die Möglichkeit, die Ergebnisse untereinander zu vergleichen, ebenso ihre Schulsysteme und die Merkmale der Schülerschaft. Ziel ist es, aus den Daten der ÜGK Massnahmen abzuleiten, die zu weniger Unterschieden und besseren Ergebnissen und damit letztlich zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen.